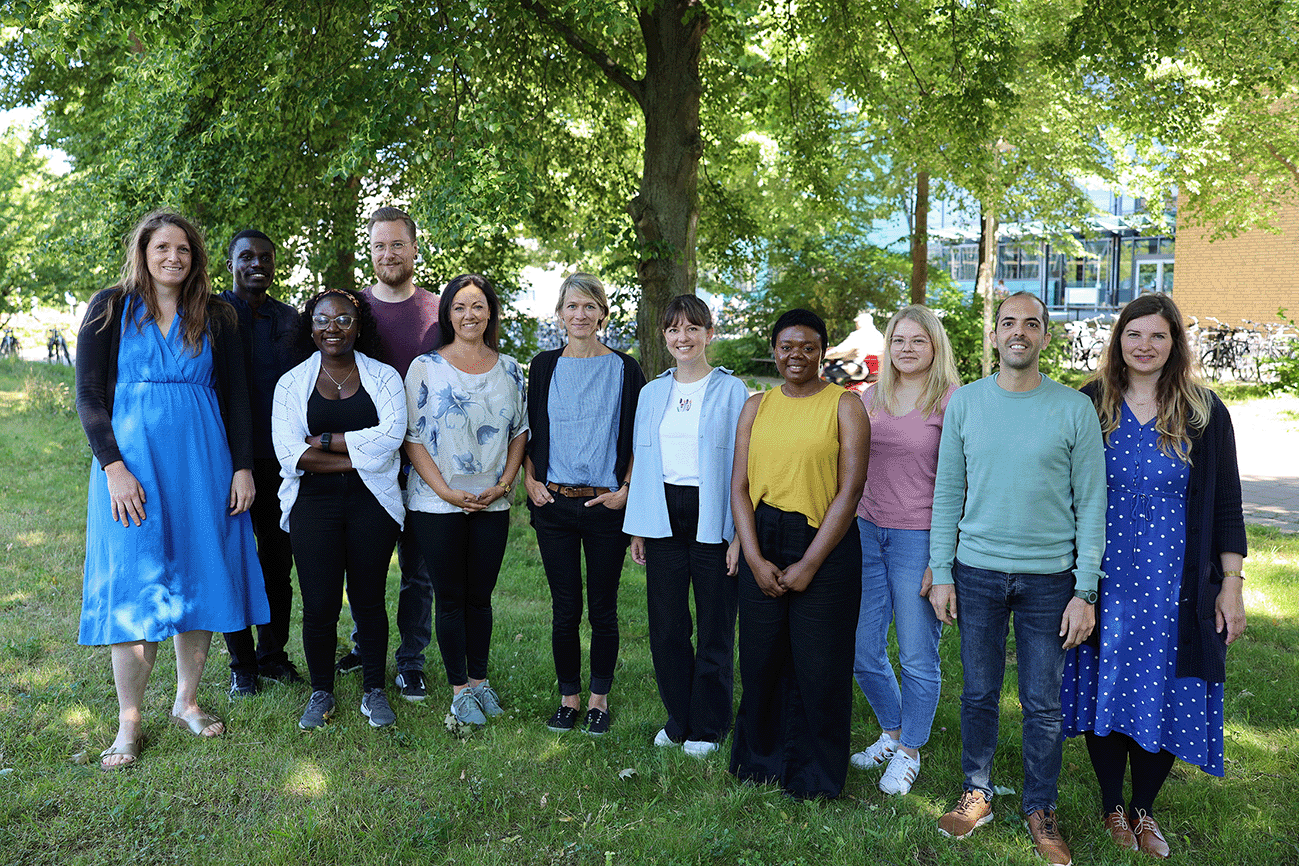Vor Ort wurde das Team herzlich von Dr. Barbara Richter und Prof. Herbert Weissenböck empfangen, die sowohl die wissenschaftliche als auch die logistische Umsetzung des Aufenthalts maßgeblich unterstützten. Sie ermöglichten den Zugang zur bedeutenden pathologischen Sammlung der Veterinärmedizinischen Universität Wien – der größten ihrer Art in Europa. Die Sammlung umfasst über 6.000 Präparate, von denen viele aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammen. Thematisch geordnet und in Vitrinen ausgestellt, dokumentieren sie eindrucksvoll organische Veränderungen durch Infektionskrankheiten wie Rinderpest und Rotz, die heute in Mitteleuropa kaum noch vorkommen. Als einzigartiges wissenschaftshistorisches Archiv spielt die Sammlung bis heute eine zentrale Rolle in der veterinärmedizinischen Ausbildung und Forschung.

Auf den Spuren historischer Krankheitserreger in Wien
Die Journalistin Laura Salm-Reifferscheidt begleitete die praktische Arbeit vor Ort im Rahmen eines Sonderbeitrages. Parallel dazu wurden laufende Projekte zu bedeutenden Tierseuchenerregern wie aviärer Influenza (Vogelgrippe), Maul- und Klauenseuche sowie Rinderpest diskutiert. Ein besonderer Höhepunkt des Retreats war die Teilnahme von Prof. Ludovic Orlando (CAGT, Universität Toulouse) und Prof. Laurent Frantz (LMU München), deren ausgewiesene Expertise in der Analyse alter DNA und Tiergenomik wertvolle Impulse für zukünftige Kooperationen setzte.
Am letzten Tag führte die Zusammenarbeit mit Dr. Eduard Winter das PAEV-Team in den historischen Narrenturm – Europas erste psychiatrische Einrichtung und heutiger Standort einer der ältesten pathologisch-anatomischen Sammlungen des Kontinents. Die dort präsentierten humanmedizinischen Präparate boten einen aufschlussreichen Vergleich zur veterinärmedizinischen Sammlung und eröffneten neue Perspektiven für interdisziplinäre Ansätze in der historischen Erregerforschung.
Das Retreat zeichnete sich durch intensiven wissenschaftlichen Austausch, anregende Gespräche und produktive Diskussionen aus, die zahlreiche Impulse für zukünftige Projekte gaben. Im gemeinsamen Dialog wurde beschlossen, die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen im Bereich der Paläogenomik von Tieren, also Genomanalysen alter tierischer DNA, zu vertiefen – mit dem Ziel, die Auswirkungen historischer Veränderungen in Zuchtpraktiken und im Tiergesundheitsmanagement auf Wirt und Erreger interdisziplinär zu erforschen.
Die Verbindung aus praktischer Forschungsarbeit, interdisziplinärem Austausch und kollegialem Miteinander machte den Aufenthalt in Wien besonders wertvoll. Die enge Zusammenarbeit vor Ort stärkte nicht nur die laufenden Projekte, sondern bildete auch eine solide Grundlage für künftige Kooperationen.
Text: Annika Graaf-Rau