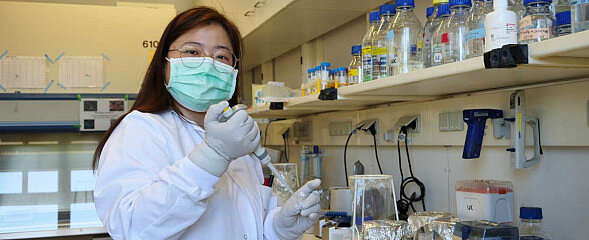Bei der fünften Portfolio-Konferenz des IBT im TRAFO Hub in Braunschweig wurden die beiden Projekte als Gewinner gekürt, nachdem sie sich gegen fünf weitere Teams aus niedersächsischen Forschungseinrichtungen durchgesetzt haben. Mit dem Fördergeld soll es gelingen, die Forschungsergebnisse möglichst schnell klinisch zu erproben und durch die Gründung von Startups auch wirtschaftlich erfolgreich zu machen.
Das sind die Gewinner-Teams:
Citrapeutics (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig)
Citrapeutics möchte die Krebsbehandlung revolutionieren und den Patient:innen eine Alternative zu gängigen Immuntherapien bieten. Das Projektteam unter der Leitung von PD Frank Pessler, Leiter der Arbeitsgruppe „Biomarker in Infektionskrankheiten“ am TWINCORE – Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung, entwickelt niedermolekulare Hemmstoffe für eine neuartige orale Immuntherapie bei Krebs. Geplant ist, den derzeit vielversprechendsten Wirkstoff Citra01 weiter zu optimieren sowie weitere zu generieren. Das TWINCORE ist eine gemeinsame Einrichtung des HZI und der MHH.
RNA Healer (Medizinische Hochschule Hannover)
RNA-Healer entwickelt ein RNA-basiertes Medikament für Patient:innen mit fortgeschrittener chronischer Leberfibrose. Ziel ist es, die verheerende Narbenbildung zu reduzieren und die Leberfunktion langfristig zu verbessern.
Insgesamt sieben Teams aus den führenden niedersächsischen Forschungseinrichtungen der Lebenswissenschaften, Leibniz Universität Hannover, Medizinische Hochschule Hannover, Georg-August-Universität Göttingen, Universitätsmedizin Göttingen und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, haben ihre Ideen im Rahmen des IBT-Events präsentiert. Die vorgestellten Projekte decken eine große Bandbreite von biomedizinischen Innovationen in den Bereichen Immunologie, Neurodegeneration, medizinische Robotik und Bildgebung, KI-basierte Lösungen und Wirkstoffentwicklung ab.
Entsprechend schwierig war die Entscheidung für die Jury unter dem Vorsitzenden Prof. Peter Hammann (Consultant, ehem. Sanofi) und der Vize Vorsitzenden Prof. Helga Rübsamen-Schaeff (AiCuris).
„Ich freue mich sehr über die überzeugende Qualität der Anträge und das stets wachsende Interesse an unseren Angeboten. Mit der IBT-Förderung möchten wir die besten Projektideen beschleunigen, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft vorantreiben und neue standortübergreifende Kooperationen in Niedersachsen ermöglichen.”, sagt Prof. Thomas Sommer, Direktor des IBT Lower Saxony.
Von der Idee zur Gründung
Den neu geförderten IBT-Projekten steht insgesamt eine Unterstützung von knapp 2,5 Millionen Euro für eine Laufzeit von zwei Jahren zur Verfügung. In der ersten Phase der Förderung erfolgt die zügige wissenschaftliche und marktorientierte Weiterentwicklung, damit aus einer Forschungsidee eine Geschäftsidee wird und mit einem fundierten Businessplan zeitnah eine Unternehmensgründung erfolgen kann. Danach liegt der Fokus auf der Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie darauf, weitere externe Finanzierung zu ermöglichen. Mit den zwei neuen Projekten befinden sich inzwischen zehn Projekte mit einer Gesamtförderung von fast elf Millionen Euro im IBT-Portfolio.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde die sechste Ausschreibung für die Auszeichnung im kommenden Jahr veröffentlicht. Die nächste Portfolio-Konferenz findet am 5. Mai 2026 in Hannover statt.