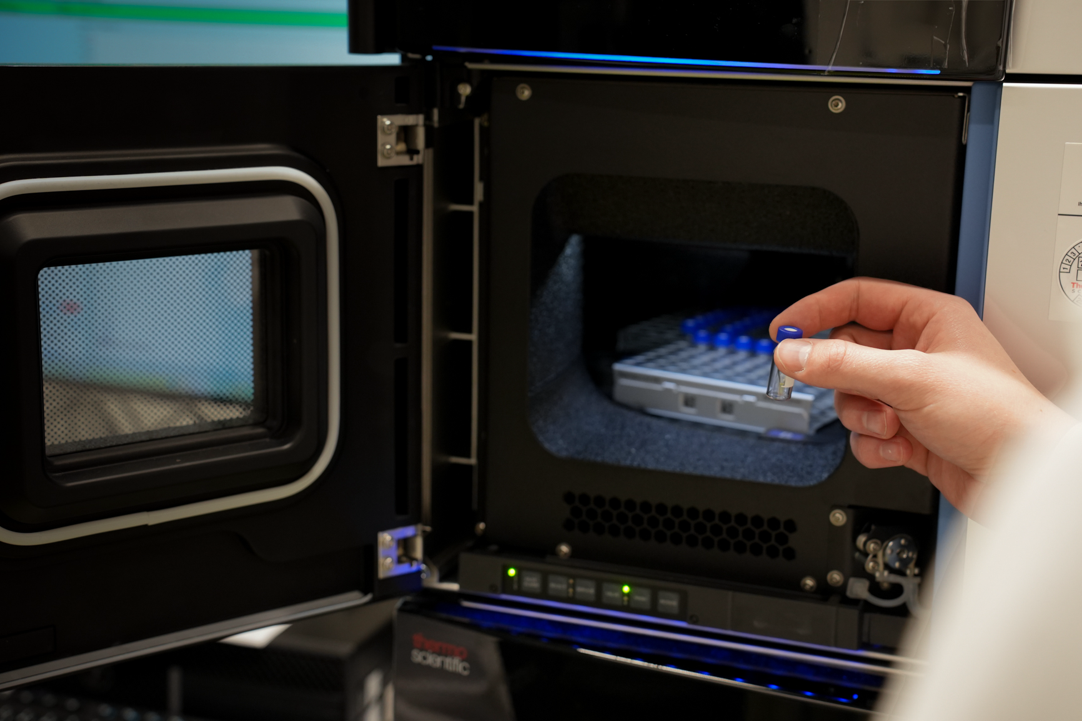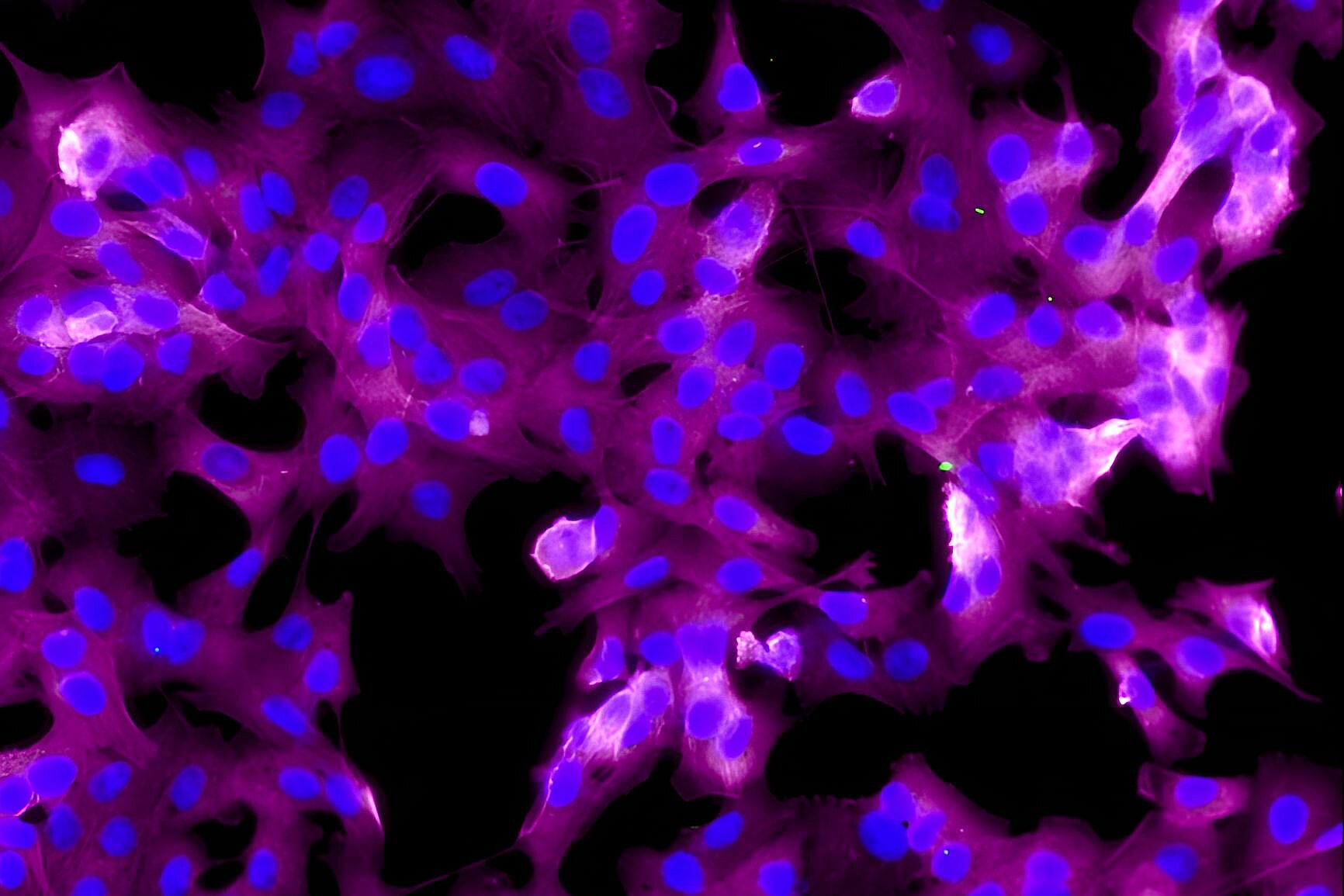Im Laufe der Evolution haben Bakterien wie kaum eine andere Art von Organismen gelernt, sich an widrige Lebensbedingungen anzupassen. Es verwundert demnach nicht, dass die von ihnen produzierten Naturstoffe ein breites Spektrum biologischer Aktivitäten abdecken. Eine Gruppe von Naturstoffen mit besonders breitem Wirkungsspektrum sind die bislang noch relativ wenig untersuchten PoTeMs (polyzyklische Tetramasäure-haltige Macrolactame). Der erste bekannte Vertreter dieser Gruppe ist das bereits 1972 entdecke Ikarugamycin, welches Wirkung gegen Bakterien und Protozoen zeigt. Die Entwicklung von PoTeMs zu Medikamenten war bislang kaum möglich, da diese nur sehr aufwändig und kostenintensiv hergestellt werden konnten und kaum Möglichkeiten vorhanden waren, um diese strukturell zu modifizieren. Einem Forschungsteam um Tobias Gulder, Leiter der HIPS-Abteilung Naturstoff-Biotechnologie, ist es nun in drei Forschungsarbeiten gelungen, diese Probleme erfolgreich zu adressieren. In einer ersten Studie etablierte das Team ein effizientes biotechnologisches Verfahren, mit dem PoTeMs wie Ikarugamycin in großen Mengen produziert werden können. In einer darauf aufbauenden Studie entwickelten sie ein genetisches „Plug-and-Play-System“, das es erlaubt, an ausgewählten Stellen Sauerstoff in die PoTeM-Strukturen einzubringen und damit deren Eigenschaften gezielt zu verändern. Um das pharmazeutische Potenzial von PoTeMs noch weiter auszuschöpfen, verfolgten die Forschenden chemo-enzymatische und molekularbiologische Ansätze, um erstmals auch deren Kernstruktur erfolgreich zu modifizieren. Die Ergebnisse dieser dritten Studie veröffentlichte das Team nun in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie International Edition. Das HIPS ist ein Standort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes.
„Die Synthese von Ikarugamycin durch Bakterien lässt sich ganz grob in zwei Schritte unterteilen“, sagt Sebastian Schuler, der an allen drei Studien beteiligt war. „Zunächst wird das Vorläufermolekül Lysobacterene A durch den Enzymkomplex IkaA hergestellt. Hierbei kommen als Bausteine Acetat sowie die Aminosäure Ornithin zum Einsatz. Lysobacterene A wird anschließend durch die PoTeM-Zyklasen IkaB und IkaC (kurz: IkaBC) zu einem ringförmigen Molekül – dem Ikarugamycin – umgewandelt. Als wir IkaBC im Labor isoliert und genauer untersucht haben, konnten wir herausfinden, dass die Zyklasen nicht nur Lysobacterene A, sondern auch ähnliche Moleküle umwandeln können, die wir zuvor chemisch synthetisiert hatten.“ In der Folge ist es dem Team mit dieser Strategie gelungen, mit Homo-Ikarugamycin einen bislang noch völlig unbekannten PoTeM-Naturstoff herzustellen. Hierzu setzten die Forschenden eine synthetische Vorläufersubstanz ein, deren Molekülgerüst um eine Kohlenstoffeinheit länger ist als bei Lysobacterene A.
Aufgrund der aufwändigen Herstellung des Vorläufers ging das Team noch einen Schritt weiter: „Statt die erste Hälfte der Synthese von Homo-Ikarugamycin chemisch zu bewerkstelligen, haben wir uns gefragt, ob wir IkaA so verändern können, dass es auch längere Kohlenstoffverbindungen zur Herstellung von Lysobacterene A verwendet“, sagt Tobias Gulder. „Hierzu haben wir den Teil von IkaA, der für die Auswahl des Aminosäure-Bausteins zuständig ist, gentechnisch so verändert, dass er statt Ornithin die um eine Kohlenstoffeinheit längere Aminosäure Lysin akzeptiert. So konnten wir IkaA dazu bringen, die vormals synthetisch hergestellte Vorstufe selbst zu produzieren, die anschließend von IkaBC zu Homo-Ikarugamycin umgewandelt wurde. Das Beste daran: Alle diese Schritte finden im lebenden Bakterium statt.“ Die Herstellung von Homo-Ikarugamycin durch Bakterien ist nicht nur deutlich einfacher als eine chemische Synthese, sondern ist auch kostengünstiger und verbraucht weniger Ressourcen.
In Zukunft sollen die etablierten Technologien als Grundlage genutzt werden, um weitere neue PoTeMs zu produzieren. Dazu könnte die modifizierte Version von IkaA beispielsweise mit anderen Zyklasen als IkaBC kombiniert werden. Langfristig wollen Gulder und sein Team so das pharmazeutische Potenzial der PoTeMs erschließen und vielversprechende Moleküle zu Wirkstoffen für die Behandlung von Infektionserkrankungen entwickeln. Tobias Gulder ist bereits seit Ende 2023 Abteilungsleiter am HIPS und Professor an der Universität des Saarlandes, hat bislang allerdings noch an der TU Dresden geforscht. Im Laufe des Jahres erfolgt der vollständige Umzug seines Teams nach Saarbrücken.